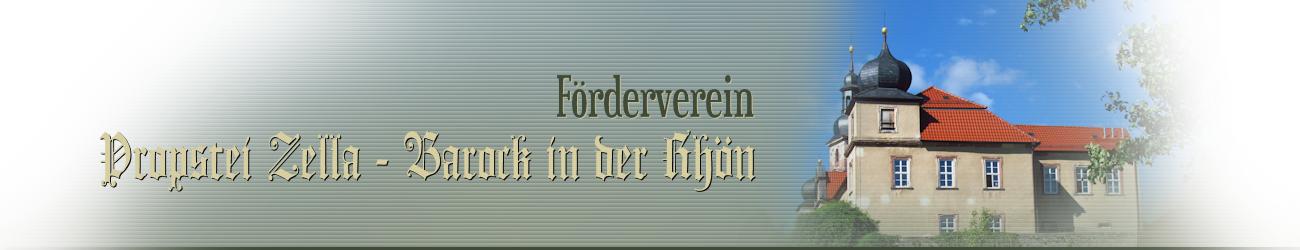
Die Propsteianlage Zella zählt zu den herausragenden Bauwerken des Rhöner Barock. Dazu gehören das ehemalige Propsteigebäude, die prunkvolle Propsteikirche, der Ehrenhof, die Schlossscheune und der Barockgarten.
| 1136 | Die Propstei geht auf das Benediktinerinnenkloster Zella zurück, das durch den Grafen Erpho von Neidhartshausen gegründet wurde. |
| 1186 | Das Kloster wird zur Abtei erhoben. |
| 1284 | Das Kloster gehört mit 14 weiteren zur Fürstabtei Fulda. |
| 1525 | Im Bauernkrieg wird das Kloster zerstört, wieder aufgebaut und schließlich 1550 aufgehoben. Die Propstei übernimmt danach die Verwaltung der Güter. Gut einhundert Jahre später brennen das Propsteigebäude und die alte Klosterkirche ab. |
| 1718 | Das Propsteischloss wird durch den Architekten der Fürstbischöfe und den italienischen Hofbaumeister Andrea Gallasini neu aufgebaut. Gallasini entwirft auch die katholische Propsteikirche Mariä Himmelfahrt, die 1732 vollendet wird. |
| 1802 | Mit der Säkularisierung wurde die fuldaische Propstei aufgehoben und zum großherzoglichen Kammergut. |
| 1911 | Teile des Gutes werden an die Bewohner von Zella verkauft, das Propsteigebäude verbleibt bis heute im Eigentum der öffentlichen Hand. |
| 1989 | Die Gemeinde Zella ist seit der Wende Eigentümerin der Propstei. Ein Teil der Innenräume im Erdgeschoss sowie ein Großteil der Kellerräume wurden saniert und werden regelmäßig für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt. |
Das Bauen in der Rhön steht seit Jahrhunderten unter dem Einfluss verschiedener Herrschaftszentren und derer Bauauffassung und Baumeister. In der Zeit des Barock sind es der Fürstbischhöfliche Fuldische Hof, die Fränkische Fürstbischöfliche Residenz in Würzburg sowie die Ernestinisch-Hennebergischen Herzogshäuser Sachsen-Weimar-Eisenach sowie Sachsen-Gotha und Coburg, später Sachsen-Meiningen.
Darüber hinaus sind barocke Bauwerke in der Rhön durch bescheidene Zweckmäßigkeit geprägt, was sich teilweise in der Auswahl der Baumaterialien, der Reduzierung der Ausstattung, der Wiederverwendung älterer Bauwerke oder Bauwerksteile sowie einer gewissen Schlichtheit bei der Fassadengestaltung wiederspiegelt. Diese Zwänge haben neben der verschiedenen stilistischen und konstruktiven Handschrift der Architekten und den individuellen Wünschen der Bauherren eine außergewöhnliche Vielfalt in einer sehr baufreudigen Epoche hervorgebracht.
 |
 |
 |
___________________________________________________________________________
|
|
||